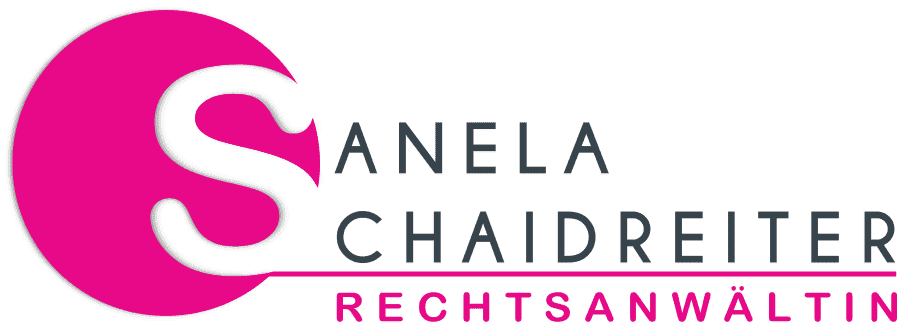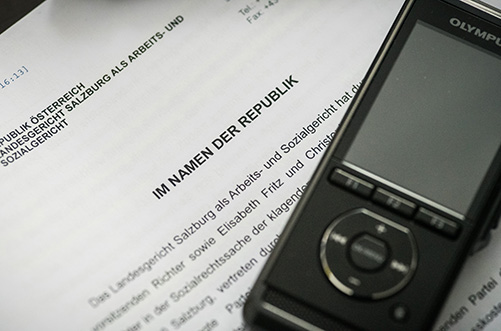Neuer Rahmenkollektivvertrag für das Hotel- und Gastgewerbe
Der neue Rahmenkollektivvertrag für das Hotel- und Gastgewerbe verbessert die Rahmenbedingungen und soll nach dem Willen der Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer insgesamt die Branche attraktiver machen und künftig für mehr Beschäftigte sorgen. Es wurden folgende Neuerungen beschlossen:...